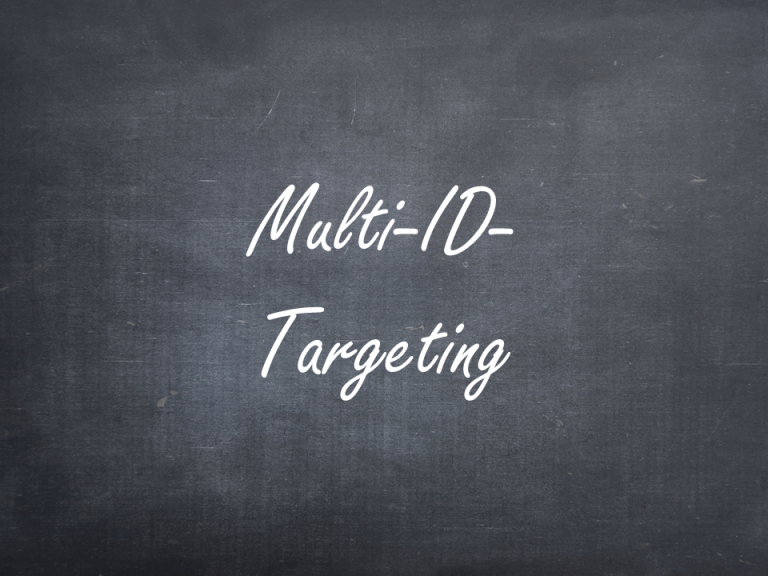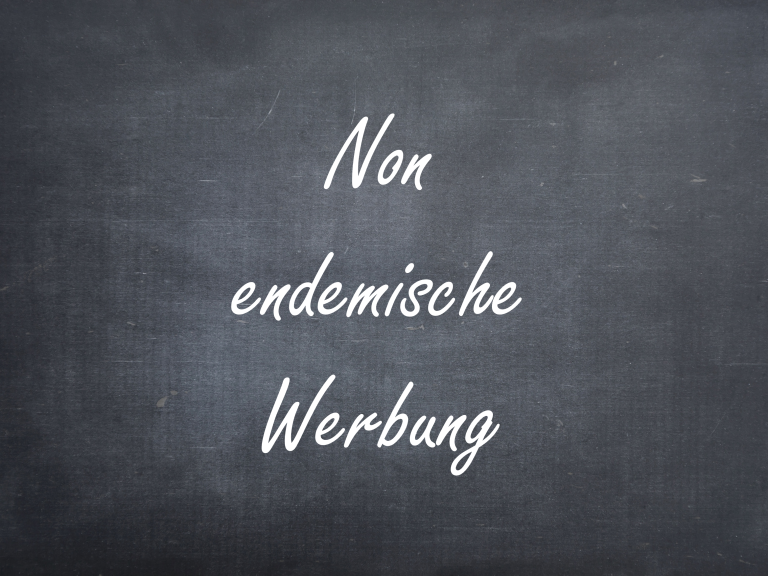Die E-Privacy-Verordnung (engl. electronic privacy „elektronische Privatsphäre“) soll dazu dienen, den Datenschutz auf elektronischen Plattformen, vor allem im Internet, zu erhöhen. Sie wurde 2002 von der Europäischen Union eingeführt und regelt die minimalen Vorgaben, die zum Schutz persönlicher Nutzerdaten eingehalten werden müssen.
Ergänzend zur E-Privacy-Verordnung wurde 2009 eine Cookie-Richtlinie eingeführt, welche besagt, dass die Nutzer über die Verwendung von Cookies auf Websites informiert werden müssen. Diese reine Information könnte jedoch zukünftig nicht mehr ausreichend sein. Die bisher hauptsächlich national geregelte E-Privacy-Richtlinie soll nun im Zuge der EU Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO /engl. GDPR – General Data Protection Regulation) zum 25. Mai 2018 ausgeweitet und EU-weit vereinheitlicht werden. Zukünftig soll sie nicht mehr nur einen besseren Schutz vor verschlüsselter Kommunikation und Tracking bieten, sondern zusätzlich Cookie Walls abwehren sowie Offline-Tracking durch Bluetooth und öffentliche Netzwerke blockieren. Befürworter der neuen E-Privacy-Verordnung betonen vor allem die verbesserten Rechte, die es den Nutzern ermöglichen, bei dem Besuch elektronischer Plattformen ihre Privatsphäre zu wahren. So soll ein Nutzer beim Besuch einer Website künftig durch ein sogenanntes „Opt-in“ aktiv seine Einwilligung erteilen müssen, bevor seine Nutzerdaten durch Cookie-Tracking gesammelt werden dürfen. Die Verwendung und Verarbeitung der Daten werden des Weiteren nur dann möglich sein, wenn sie als „streng erforderlich“ oder „streng technisch notwendig“ gelten. Auch wird es für den Nutzer die Option geben, die Verwendung von Cookies auf Affiliate Websites gänzlich abzulehnen, bereits bevor diese gesetzt werden. Die betreffende Website darf er dennoch benutzen. Die Gegner der E-Privacy-Richtlinie wiederum befürchten, dass die digitale Wirtschaft durch massive Einschränkungen für die Online Marketing-Branche Schaden nimmt. Weil der Nutzer seine Einwilligung zur Speicherung von persönlichen Daten und Surfverhalten verweigern kann, bestehe die Gefahr dass viele Nutzerdaten verloren gehen. Diese bilden jedoch beispielsweise für Affiliate Marketing-Betreiber die Grundlage ihrer Entscheidungen zu Werbemaßnahmen. Des Weiteren müssten auch Tracking-Spezialisten, Targeting-Anbieter und Programmatic Advertiser sowie Online Journalisten mit Veränderungen und Einschränkungen rechnen. Ferner kann sich die Erweiterung der E-Privacy-Verordnung negativ auf die User Experience auswirken. Wenn ein Nutzer beispielsweise beim Besuch von Websites wieder und wieder um sein Einverständnis zu personalisierter Werbung gebeten wird, kann dies auf den Nutzer frustrierend wirken. Zudem entwickeln sich größere Streuverluste durch den weniger gezielten Einsatz von Werbung. Da die Werbung generell aber nicht eingeschränkt wird, besteht die Möglichkeit dass Werber die Streuverluste durch das Schalten von mehr Werbung zu kompensieren versuchen. Eine unkontrollierte Menge an Werbung wäre die Folge. Diese Menge an Werbung führte dann dazu, dass der Nutzer einerseits mehr Werbung sieht und andererseits auch die Relevanz dieser Werbung für ihn sinkt. Welches Szenario auch immer Realität wird, die Online Marketing-Branche sieht sich einer intensiven Zeit der Vorbereitungen gegenüber.